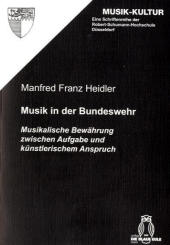|
MUSIK-KULTUR Eine Schriftenreihe
der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf Band 12 Manfred
Franz Heidler Musik in
der Bundeswehr Essen 2005,
656 Seiten mit CD-Rom, 58,00 EUR [D], ISBN 3-89924-123-1 Themenstellung:
Diese Arbeit versucht, ausgehend von den frühsten politischen Planungen der
sog. deutschen Wiederbewaffnung ab 1950 bis zur derzeitigen Ausformung, den
Weg des Militärmusikdienstes der Bundeswehr nachzuzeichnen. Manfred
Franz Heidler, geboren 1960 in Donauwörth/Bayern. Berufsausbildung als Flach-
und Hochdrucker. 1979 Eintritt in die Bundeswehr, Instrumental-Studium
(Tenorhorn u. Posaune) am Robert-Schumann-Institut Düsseldorf der Hochschule
für Musik Rheinland, Köln. Verwendung als Musikfeldwebel beim Heeresmusikkorps
2, Kassel. Studium der Instrumentalpädagogik an der Musikhochschule in
Detmold. 1987 - 1990 Ausbildung zum Musikdienstoffizier. 1990 - 1999 Lehr-
und Ausbildungsoffizier beim Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr. 1994
Abitur am Abendgymnasium Wuppertal. 1997 Studium der Musikwissenschaft an der
Robert-Schumann-Hochschule, Erziehungswissenschaft und Psychologie an der
Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. 2003 externe Kapellmeisterprüfung.
2004 Promotion zum Dr. phil. Derzeit zweiter Musikoffizier beim
Luftwaffenmusikkorps 2, Karlsruhe. Buchtipp: Musik in der BundeswehrDüsseldorf/Essen,
08.02.2006, INTRANET aktuell.
Es handelt sich dabei um seine Doktorarbeit,
veröffentlicht in der Schriftenreihe „Musik-Kultur“ der
Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, der höchsten Ausbildungsstätte für
deutsche Militärmusiker. Die gewaltige Arbeit hat der Autor in zwei Teile
„gepackt“, einen „detailversessenen“, umfangreichen Textband und eine
hervorragend gestaltete CD-ROM.
Militärmusik, wie wir sie heute kennen, ist
eine mehr als 600 Jahre alte türkische „Erfindung“. Die ersten nachweisbaren
Spuren führen aber noch weiter zurück, in den arabischen Raum des frühen
Mittelalters, nach Bagdad und nach Damaskus. Von dort kamen musizierende
Derwische mit Flöten, Pfeifen, Glocken und Trommeln um das Jahr 1320 n. Chr.
nach Kleinasien, und zwar nach Bursa an den Hofe des Osmanensultans Orchan. Auch die antiken Griechen und Römer kannten
bereits Kriegsmusik und Signalwesen. Im Früh- und Hochmittelalter bildete
sich in Europa das Landsknechtswesen und deren Musikwesen mit Trommeln und
Pfeifen heraus, gleichfalls eine wichtige Entwicklungsstufe der modernen
Militärmusik. Die Kreuzritter hatten den ersten Kontakt mit orientalischer
Militärmusik, die mit dem Vormarsch der Türken gegen das Abendland ihren
prägenden, „spielenden“ Einfluss auf die europäische Heeresmusik hinterließ. Militärmusik erfüllte seit alters her drei
wesentliche Aufgaben: Primär sollte sie im Felde der Übermittlung taktischer
oder innerdienstlicher Befehle dienen; daneben besaß sie psychologische
Wirkung als Stimulans für die angreifenden Krieger oder zur Einschüchterung
der Gegner; und schließlich kam ihr kultisch-rituelle, repräsentative oder
später sogar unterhaltende Bedeutung zu. Die Militärmusik von heute kennt nur noch
drei Aufgabenfelder: ihre Verwendung im truppendienstlichen, repräsentativen
und unterhaltenden Rahmen. Hierzu zählen etwa Vereidigungen, Zapfenstreiche
und öffentliche Konzerte. Wenn man überhaupt eine Kritik an
vorliegendem Buch anbringen könnte, wäre es die, dass eine allgemeine
historische Einleitung in das Militärmusikwesen – wie vorstehend vom
Rezensenten nur „angeklungen“ – fehlt. Was die Vor-Bundeswehr-Zeit betrifft,
widmet der Autor im ersten, gedruckten Teil seines Werkes aber immerhin ein
Kapitel der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Eine Zeitreise durch fünf JahrzehnteDoch der Schwerpunkt der Arbeit – und das
besagt ja auch der Titel – befasst sich mit der Musik in der Bundeswehr seit
ihren Anfängen und in ihrer „musikalischen Bewährung zwischen
Aufgabe und künstlerischem Anspruch“, wie es im Untertitel heißt. Die Zeitreise der sechs Kapitel zur
Bundeswehr-Musikgeschichte beginnt mit den „Grundlagen
der deutschen Wiederbewaffnung in ihrer Bedeutung für die Herausbildung einer
Militärmusik“.
Die nächsten fünf Kapitel lauten: ·
Das Amt Blank und seine musikalischen Initiativen Inneres Gefüge –Innere Führung und Militärmusik;· „Musik in Uniform“ nach 1945 – der Weg der Militärmusik;· Die bundesrepublikanische Realität: Gutachten und Denkschriften zur Reorganisation einer Militärmusik in westdeutschen Streitkräften;· Der Militärmusikdienst im Streitkräftekonzept ab 1955Die Aufstellung der ersten Musikkorps der Bundeswehr;· Der Musikbegriff der Bundeswehr.Militärmusik im 21. JahrhundertZu den „lesemusikalischen“ Leckerbissen
gehören die in einzelne Kapitel eingestreuten Exkurse, vier an der Zahl.
Hierzu zählt auch ein Abschnitt zur Geschichte der Militärmusik der
Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik. Ein anderer
lesenswerter Beitrag ist jener zum Großen Zapfenstreich, wobei auch die
gesellschaftsproblematischen Fragestellungen nicht ausgeklammert werden. Den
Abschluss bildet ein Ausblick auf Gegenwart und Zukunft der Militärmusik in
der Bundeswehr. Zu letztem Punkt schreibt der Autor zwar,
dass die Militärmusik hierzulande nur noch von einer kleinen Minderheit als
„faschistoide Knobelbechermusik“ angesehen wird, verweist aber auf „das
teilweise immer noch fragwürdige Ansehen der Militärmusik in Bereichen der
deutschen Gesellschaft. Gerade vor dem Hintergrund weiterer Diskussionen um
die Traditionspflege der Bundeswehr kann auch die Militärmusik wieder ins
Kreuzfeuer einer emotional gefärbten Kritik geraten. Sie ist daher
angehalten, auch hier mit eigenen Konzepten in die Offensive zu gehen.“ Oberst Doktor Michael Schramm, amtierender
Leiter des Militärmusikdienstes, hat die notwendige neue Positionierung zu
den gewandelten Aufgaben deutscher Militärmusik im 21. Jahrhundert so
beschrieben (zitiert nach Heidler, S. 614): „1. Integration der Truppe untereinander als
‚klingendes Selbstbewusstsein der Streitkräfte‘; 2. Integration der Bundeswehr in die
Öffentlichkeit als ‚klingender Ausdruck sicherheitspolitischen Bewusstseins
der Bevölkerung‘; 3. Integration der Bundesrepublik Deutschland
ins internationale Gefüge als ‚klingende Visitenkarte der Bundesrepublik
Deutschland‘.“ Informationsreiche CD-RomEin absolutes „Schmankerl“ ist der zweite
Teil des Gesamtwerkes, die CD-ROM. Sie bietet eine Fülle von Informationen an
Bildern, Noten sowie Text- und Tondokumenten, vom ersten Drittel des 19.
Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Darunter sind nicht wenige erstmals
veröffentlichte Belege. Der „elektronische Band“ ist dabei so
angelegt, dass die dort abgebildeten Beispiele mit den einzelnen Kapiteln des
Textbandes korrespondieren und damit das dort Beschriebene vertiefen
beziehungsweise weiter veranschaulichen und auch klanglich erlebbar werden
lassen. Abschließend bleibt nur zu sagen, dass es für
jeden, der sich mit deutscher Militärmusik beschäftigt, ein absolutes Muss
ist, den „Heidler“ zu Rate zu ziehen. |
|
Seine Dissertation wurde am 27. Juni 2006 mit dem Fritz-Thelen- Anerkennungspreis der Internationalen Gesellschaft zur Förderung und Erforschung der Blasmusik (IGEB) ausgezeichnet. Die Verleihung der Urkunde erfolgte durch den Vizepräsidenten der IGEB, Herrn Francis Pieters aus Belgien. |